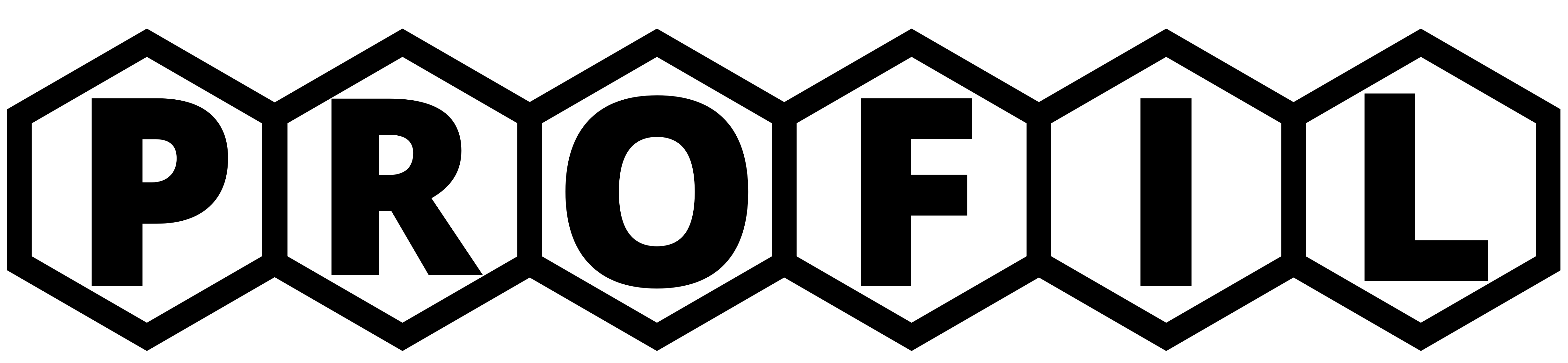„Of all the forms of inequality, injustice in health care is the most shocking and inhuman.”
(Seneque, Marie Edwige: Racism in Healthcare: Alice and Well: The Greatest Barrier to Reform, 2010, United States of America, Seite 12
Das waren die Worte des bekannten Bürgerrechtlers Martin Luther King am 25. März 1966 auf einer Pressekonferenz vor dem Kongress des medizinischen Komitees für Menschenrechte. Schon zu seiner Zeit musste er gegen den sogenannten strukturellen Rassismus im US-Gesundheitswesen kämpfen. Struktureller Rassismus meint Diskriminierungen und Vorurteile in Verhaltensweisen, Einstellungen oder Denkweisen. Welche gesundheitliche Behandlung einem Menschen demgemäß zusteht, ist von seiner Hautfarbe abhängig.

Wie Martin Luther King damals schon ansprach, ist dieser von Rassismus betroffene Lebensbereich sehr gefährdet, da es um Menschenleben geht. Und das, obwohl die Gesundheit ein in Artikel 25 der UN-Menschenrechtscharta festgeschriebenes Menschenrecht ist:
„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung […].“
Trotz allem herrscht in den USA aufgrund von Rassismus eine ungleiche medizinische Versorgung. Als eine zusätzliche Herausforderung für das Gesundheitswesen kam im Jahr 2020 die globale Corona-Pandemie hinzu, weshalb sich die Fragestellung ergibt, inwieweit die Corona-Pandemie als Beispiel für noch immer existierenden Rassismus im US-Gesundheitswesen herangezogen werden kann.
Das Gesundheitssystem der USA
Während in vielen Ländern eine Krankenversicherungspflicht herrscht, existiert in den USA keine allgemein staatliche Krankenversicherung. Aufgrund der hohen Kosten einer Versicherung verfügen viele Amerikaner*innen über keine Krankenversicherung oder sie sind unterversichert. Während in der weißen Bevölkerung nur 7,5 Prozent keine Krankenversicherung haben, sind es laut der Kaiser Family Foundation bei den Afroamerikaner*innen 11,5 Prozent. Dies bedeutet für sie, dass sie im Krankheitsfall komplett selbst bezahlen müssen, weshalb viele Amerikaner*innen gar nicht erst zum Arzt gehen. Über den Arbeitgeber haben sie jedoch teilweise die Chance krankenversichert zu werden, doch im Umkehrschluss verlieren sie mit ihrem Job demnach auch die Krankenversicherung.
In den USA besteht also kein Sozialversicherungssystem wie beispielsweise in Deutschland. Der Staat gibt weniger Vorgaben und die Gesundheitsversorgung ist beruhend auf dem Krankenversicherungssystem in die private und öffentliche Gesundheitsversorgung gegliedert. Zu privaten Krankenhäusern verfügen ausschließlich Patientinnen und Patienten mit Krankenversicherung über einen Zugang. Diese Einrichtungen bieten mehr Annehmlichkeit, mehr Privatsphäre und wesentlich kürzere Wartezeiten.
Da die meisten privat geführt werden, sind diese auch wesentlich teurer. Günstiger sind sie nur, wenn sie von gemeinnützigen Organisationen oder durch private Vorstände von Investoren geführt werden.
Öffentliche Krankenhäuser sind in Amerika im Vergleich zu privaten Krankenhäusern eher selten. Eine Krankenversicherung muss für den Zutritt und die Behandlung nicht vorliegen. Dafür sind die Wartezeiten jedoch länger, Krankheitskosten werden als Privatangelegenheit angesehen und Behandlungen sind trotz der öffentlichen Gesundheitsversorgung noch teurer, als es in anderen Ländern der Fall ist.
Der Ursprung des strukturellen Rassismus im US-Gesundheitswesen
Alleinig der Aufbau des Gesundheitswesens stellt dementsprechend schon eine Ursache von strukturellem Rassismus dar, jedoch gab es in der Historie der USA weitere Fakten, die für Nachteile und Misstrauen bei den Afroamerikaner*innen sorgten.
Einfluss sozialer Ungleichheiten anderer Lebensbereiche
Das Gesundheitssystem der USA fordert, wie bereits erläutert, ein hohes Einkommen oder Vermögen, um sich eine kompetente Gesundheitsversorgung leisten zu können. Da soziale Ungleichheiten neben dem Gesundheitswesen auch Bereiche wie das Bildungswesen, den Arbeitsmarkt oder das Wohneigentum betreffen, werden die Möglichkeiten der schwarzen Bevölkerung in den USA eingeschränkt.
Die Konsequenz eines erschwerten Zuganges zur Bildung ist ein beschränktes Beschäftigungspotential. Im Einstellungsprozess haben Schwarze häufig aufgrund ihrer Hautfarbe mit Schwierigkeiten zu kämpfen, erlangen somit geringerwertige Jobs und ein niedrigeres Einkommen. Das mittlere Vermögen schwarzer College-Absolventen beträgt nur 23.400 US-Dollar im Vergleich zu 180.500 US-Dollar für weiße College Absolventen.
Banken gewähren Weißen mit niedrigerem Einkommen ebenfalls eher Kredite als Schwarzen mit mittlerem bis hohem Einkommen, und in Anbetracht dessen können die Letztgenannten sich nur Wohnungen in Randgebieten leisten. Die Segregation, die räumliche Abbildung sozialer Ungleichheiten in der Gesellschaft, ist also schon lange deutlich erkennbar
Tuskegee-Syphilis-Studie
Die im Jahre 1932 in Alabama durchgeführte „Tuskegee-Syphilis-Studie“ von der Behörde des Gesundheitsministeriums der Vereinigten Staaten ist ebenfalls ein wichtiges Element in der Historie der USA, um den strukturellen Rassismus im Gesundheitswesen zu erläutern.
Die „Tuskegee-Syphilis-Studie“ beschreibt eine Untersuchung der Geschlechtskrankheit Syphilis, bei der bleibende Schädigungen der Haut, der Organe, des Gehirns und der Knochen zurückbleiben können. Die Studie gilt als einer der längsten und grausamsten Menschenversuche, die je unter staatlicher Aufsicht in den USA existierten. Statt den an Syphilis erkrankten Menschen eine angemessene Behandlung zukommen zu lassen, wurde im Rahmen der Studien eine „kostenlose Versorgung“ angeboten. Reihenweise fielen die Menschen auf diesen Köder rein. Die Ärzte zielten bei den Afroamerikaner*innen jedoch keine Heilung an, sondern spielten mit gefärbten Aspirintabletten und der Durchführung nicht therapeutischer Vorgehen eine Behandlung vor. Der Direktor des Tuskegee-Expiments, Raymond A. Vonderlehr, äußerte damals:
„So, wie ich das sehe, haben wir kein weiteres Interesse an den Patienten, bis sie sterben.“
Raymond A. Vonderlehr
Bei alledem ging es den Fachkräften demzufolge ausschließlich um die Untersuchung der Leichen, um die Folgen feststellen zu können.
Neben den schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen wie entzündlichen Wucherungen, Blindheit und psychischen Störungen durch eine Beeinträchtigung des Herz- und Nervensystems blieb in der Gesellschaft ein großes Misstrauen. Die afroamerikanische Bevölkerung befand sich aufgrund des unmoralischen und rassistischen Verhaltens in einem Schockzustand. Den Ursprung der afroamerikanischen Arztphobie und der mangelnden Vertrauenswürdigkeit in das US-Gesundheitssystem bildet seit dieser Zeit die Tuskegee-Studie.
Rassistische Ungleichheiten im US-Gesundheitswesen
Aus diesen prägenden Ereignissen resultieren im US-Gesundheitswesen also einige rassistische Ungleichheiten.
Medizinisches Personal
Die ethnische Vielfalt ist schon beim medizinischen Personal sehr gering, welches auf die eingeschränkten Bildungsmöglichkeiten zurückzuführen ist. Nur 5 Prozent der Ärzte sind schwarz, 56 Prozent der Ärzte sind weiß, 17 Prozent asiatisch und 6 Prozent hispanisch. Eine gute Vertrauensgrundlage schafft diese geringe Prozentzahl für afroamerikanische Patientinnen und Patienten aufgrund diverser Vorprägungen nicht unbedingt.
Umgang mit den Patienten
Bei einer größeren ethischen Vielfalt wäre außerdem auf einen ausgeglicheneren Umgang mit den Patienten zu hoffen. Afroamerikaner*innen müssen häufig mit unangemessenen Reaktionen bei Symptomen rechnen.
Die Ärzte sind partiell noch der Meinung, dass Schwarze leidensfähiger sind. Darüber hinaus werden laut einer Studie von „Station et al“ aus dem Jahr 2016 nur bei 33,5 Prozent der Weißen die Schmerzen unterschätzt, während es bei den Schwarzen 47 Prozent waren. Ein solcher Gedankengang lässt sich bereits bei Medizinstudierenden in den USA feststellen. Demgemäß glauben 40 Prozent der Medizinstudierenden, dass Schwarze Patientinnen und Patienten Schmerz anders beziehungsweise vermindert wahrnehmen.
Die rassistische Denkweise des Personals sorgt des Weiteren im Falle von Schwangerschaften, Schmerzen oder Herzkrankheiten für keine auf ihre Bedürfnisse angepasste Behandlung. Somit ist beispielsweise die Wahrscheinlichkeit während einer Schwangerschaft zu sterben, für Schwarze drei- bis viermal höher als bei Weißen.


Rassismus im Gesundheitswesen zu Zeiten der Corona-Pandemie
Im Jahr 2020 trat dann eine weitere medizinische Herausforderung auf. Die Corona-Pandemie forderte global ein starkes Gesundheitssystem, welches einen wichtigen Teil zur Pandemiebekämpfung beitragen musste. Doch da das Gesundheitssystem der USA erwiesenermaßen schon vorher gravierende Probleme mit Rassismus aufwies, wurden es schwere Zeiten für die Afroamerikaner*innen.
Impfungen & Tests
Schwierigkeiten zeichneten sich bereits bei den Corona-Schutzimpfungen ab. Der Zugang zu einem COVID-19-Impfstoff wurde in verschiedene Prioritätengruppen unterteilt. Oberste Priorität besaßen anfangs Menschen ab einem Alter von 85 Jahren. Da Afroamerikaner*innen aber eine wesentlich geringere Lebenserwartung haben, profitierten sie nicht zwingend von dieser Regel. Im Schnitt sterben sie 4 Jahre früher als Weiße.
Und obwohl viele Afroamerikaner*innen zwar in systemrelevanten Berufen, wie beispielsweise als Busfahrer*innen, Pfleger*innen in Altenheimen oder Supermarkt-Verkäufer*innen arbeiteten, zählten sie trotz allem nicht zur entsprechenden Prioritätengruppe. Arbeiten von Zuhause aus ist in diesen Berufen nicht möglich. Eine Studie des Amtes für Arbeitsmarktstatistik, welche bereits vor Corona entstanden ist, belegt dies ebenso. Laut ihr arbeiten nur 3 Millionen schwarze Menschen in Jobs, in denen Homeoffice möglich ist. Bei den weißen US-Amerikanern war es auch hier mit 34 Millionen wieder die eindeutige Mehrheit. Dadurch waren Afroamerikaner*innen zudem einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt.
Eine weitere Erschwernis kam durch den schlechteren Zugang zum Internet zustande. Auch an dieser Stelle weisen andere Bereiche des strukturellen Rassismus ihre Einflüsse auf. Einige Afroamerikaner*innen können sich aufgrund ihres schlechteren Einkommens keinen Zugang leisten, andere wohnen hingegen in finanzschwächeren Wohngebieten, die mit keiner ausreichenden Netzinfrastruktur ausgestattet sind. Häufig konnte man sich jedoch ausschließlich über Webseiten zu einer COVID-19-Impfung anmelden, sodass ihnen hier der Zugang verwehrt wurde.
Die Ansiedlung der Afroamerikaner*innen in sozial schwächeren Wohngebieten bringen zudem einen weiteren Nachteil mit sich, da Impfzentren häufig in wohlhabenderen Gebieten lokalisiert wurden.
Statt diesen erschwerten Zugang zu den Corona-Schutzimpfungen zu thematisieren, wurden Afroamerikaner*innen schnell als Impfskeptiker betitelt. Eine gewisse Skepsis bei dieser Thematik lässt sich sicherlich auf die Prägung mit der Tuskegee-Syphilis-Studie zurückführen – ein gewisses Misstrauen ist hier nicht auszuschließen. Die Behauptung, dass Afroamerikaner*innen aber bewusst die Herdenimmunität verhindern wollen, führt aber sicherlich zu weit.
Auch für Impftests wurden Afroamerikaner*innen häufig auserwählt. Alleine dies weist auf eine schlechte Moral der Ärztinnen und Ärzte hin und die Grundsätze medizinischer Forschung werden in diesem Fall missachtet. Auch in der Deklaration des Weltärztebundes, dem ärztlichen Gelöbnis, werden jegliche Formen von Diskriminierung eigentlich ausgeschlossen:
„Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft […] zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten.“
Der Großteil der Ärztinnen und Ärzte der USA hält sich in der Praxis allerdings nicht an dieses ärztliche Gelöbnis und unterscheidet sehr wohl nach Faktoren wie der Herkunft und der Hautfarbe.
Zusätzlich wurde stets verbreitet, dass Afroamerikaner*innen sich gegen klinische Versuche zur Wehr setzen würden, allerdings zeigt eine Studie genau das Gegenteil. Der Anteil an Afroamerikaner*innen an der US-Bevölkerung beträgt 12,3 Prozent und von diesen haben insgesamt 10 Prozent teilgenommen. Derartige Informationen an die Bevölkerung wurden jedoch nicht weitergeleitet. Angewendet wird hier ganz bewusst das sogenannte “Framing“. Dieses Wort steht für die bewusste Eingrenzung von Informationen, sodass die weiße Bevölkerung die Afroamerikaner*innen ausschließlich als Verweigerer der Studien wahrnehmen konnten.
Der Weg der Übertragung, die sogenannte Infektionskette, konnte über Impfungen dementsprechend kaum vermieden werden. Für Ungeimpfte blieb dann folglich als einzige Möglichkeit, um Infektionen mit dem Corona Virus zu vermeiden, die Durchführung von COVID-19 Antigentests. Doch auch hier waren sie deutlich benachteiligt und eine Ansteckung konnten auch sie nicht komplett verhindern. Zurückzuführen war dies einerseits auf das Gesundheitssystem, da die ersten Corona-Tests ausschließlich nur in privaten Krankenhäusern zur Verfügung standen. Andererseits konnten sie sich diese aufgrund von Armut und schlechterem Einkommen nicht leisten.
Bestätigt wurde der Rassismus in diesem Bereich erneut durch eine Aussage von Dr. M. Roy Wilson, welcher an der Wayne State University tätig ist. Er sagte:
„Es gibt Hinweise darauf, dass Afroamerikaner mit Symptomen nicht so häufig getestet wurden. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Latino-Erwachsene zu Beginn der Pandemie keinen Zugang zu Coronavirus-Tests hatten“
Sanchez, Gabriel R./Barreto, Matt/ Block, Ray/ Fernandez, Henry/ Foxworth, Raymond (20.10.2021): How we rise: Discrimination in the healthcare system is leading to vaccination hesitancy, Brookings. URL: https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2021/10/20/discrim[1]ination-in-the-healthcare-system-is-leading-to-vaccination-h
Der beschränkte Zugang zu Impfungen und Tests, all solches führte bei den Afroamerikaner*innen zu Vorbehalt, fehlendem Vertrauen und einer höheren Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren.
Methoden zum Vertrauensaufbau
Trotz all dieser Erschwernisse gab es aber noch Menschen, die sich weiter dafür einsetzten, dass die Afroamerikaner*innen gerade zu Corona-Zeiten die Chance bekommen, wieder Vertrauen in das US-Gesundheitswesen zu gewinnen, sodass keiner unnötig zu Schaden kommen musste. Für einen solchen Vertrauensaufbau wurden zahlreiche Projekte entwickelt.
Ein bekanntes Projekt war das sogenannte „Hair Project“ in Friseurgeschäften von Maryland, geleitet von Dr. Stephen B. Thomas. Er ist Professor und Direktor für Gesundheitspolitik und Management und setzt sich landesweit dafür ein, dass rassistische und ethnische Gesundheitsunterschiede beseitigt werden.
Die Abkürzung „Hair“ steht für die gemeindebasierende Intervention „Health Advocates In-Reach and Research“ und verfolgt das Hauptziel, zugängliche Standorte für die Gesundheitserziehung und die Bereitstellung öffentlicher medizinischer Dienstleistungen in der Gemeinde zu schaffen. Die Idee des Projekts entstand auf der Grundlage, dass viele Afroamerikaner*innen nur selten ausreichend informiert werden. Es sollte sichergestellt werden, dass alle Menschen die nötigen Informationen erhalten, um legitimierte Entscheidungen über eine COVID19 Impfung zu fällen. Eine solche Art von Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, welche staatliche Unterstützung bekam, öffnete den Menschen des Weiteren neue Wege zu vertrauenswürdigen Quellen, sodass die auf diesem Weg informierte Bevölkerungsgruppe sich eher von einer nötigen Impfung überzeugen ließ.
Als weiterer einflussreicher Arzt wäre hier Dr. Taison Bell zu nennen. Auch er engagiert sich, um einen Wandel für qualitativ hochwertige und gerechte Gesundheitsversorgung herbeizuführen. Die Gefahren des strukturellen Rassismus im Gesundheitswesen sieht er schon lange und äußert sich folgendermaßen:
„Auch wenn Corona per se keine Menschen diskriminiert, sind Schwarze in den USA durch strukturellen Rassismus stärker gefährdet.“
Dr. Taison Bell
Die Grundlage dieses Rassismus, nämlich das große Misstrauen in der afroamerikanischen Bevölkerung aufgrund von rassistischen Ereignissen wie der Tuskegee-Studie, ist ihm durchaus bewusst. Infolgedessen möchte er mit Hilfe der sozialen Netzwerken für mehr Transparenz sorgen. Hierfür postet er Bilder seiner eigenen Impfung auf Twitter, sodass er die Menschen über eine zusätzliche Quelle, zu der einige Zugang besitzen, erreichen kann.
Neben all den vielen Projekten ist geplant, zukünftig ergänzend Zeitschriften und Comic Hefte in Friseurgeschäften auszulegen, die über die Krankheit und Impfung informieren.
Sterbefälle
Dass die Zahlen der Todesfälle durch eine Corona-Infektion bei der schwarzen Bevölkerung wesentlich höher sind, verwundert aufgrund der zuvor geschilderten Fakten keineswegs.
Als Beispiel wäre anzuführen, dass im südlichen Bundesstaat Louisiana die Schwarzen einen Bevölkerungsanteil von 32 Prozent ausmachen und 70 Prozent der Toten letztendlich Schwarze waren. Betrachtet man nicht nur den Bundesstaat Louisiana, sondern die gesamte USA, so sind die Zahlen noch gravierender. Laut einer Statistik des APM Research Lab vom 26. Mai 2020 waren bei den Corona-Todesfällen je 100.000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe 54,1 Prozent schwarz und nur 22,7 Prozent weiß. Diese Zahlen belegen also den vorherig zuvor erläuterten Rassismus bei den Behandlungen der Schwarzen und nicht zuletzt deren daraus resultierende Zurückhaltung gegenüber den Impfungen.
Corona-Pandemie stellt ein geeignetes Beispiel dar
Abschließend lässt sich nun also sagen, dass die Corona-Pandemie ein sehr geeignetes Beispiel für noch immer existierenden Rassismus im US-Gesundheitswesen bildet. Das in der UN-Menschenrechtscharta festgeschriebene Recht auf Gesundheit wird weiter missachtet, in dem keine Gleichheit bei den Behandlungen von Weißen und Schwarzen herrscht. Auf die Gesellschaft wirkt der Umgang mit der afroamerikanischen Bevölkerung wie eine Durchseuchungsstrategie, da den medizinischen Fachkräften alle Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionskette bewusst sind, sie jedoch afroamerikanischen Patient*innen den Zugang zu Impfungen und Tests bewusst erschweren. Die Folgen aufgrund von rassistisch motivierten Fehlbehandlungen im Vorfeld, dass viele Afroamerikaner*innen unter einer Vorerkrankung leiden, werden missachtet. Somit sind sie umso gefährdeter, bei einer Infektion mit dem Corona-Virus einen schweren Verlauf zu erleiden oder gar zu sterben. Die Statistik über die Fallzahlen der Corona-Pandemie untermauert hier den Rassismus-Fakt.
Der Rassismus im US-Gesundheitswesen wurde folglich durch die Pandemie wieder deutlicher zum Vorschein gebracht. Der Ursprung des Rassismus lässt sich in vielen Bereichen erkennen, weshalb man durchaus von einem eng verzahnten System sprechen kann. Es funktioniert nicht, den Rassismus nur im Gesundheitswesen bekämpfen zu wollen, denn um beispielsweise eine höhere Anzahl an dunkelhäutigen Ärzten zu erreichen, müsste man auch den Rassismus im Bildungswesen bekämpfen. Um der schwarzen Bevölkerung dieselben Chancen auf eine angemessene Behandlung zu gewährleisten, müsste zudem die Vermögensverteilung gerechter werden. All dies sind nur ein paar gewählte Beispiele, die zeigen, dass eine deutliche Beeinflussung des vorliegenden Rassismus aus diversen Lebensbereichen herrscht.

Als Konsequenz ist es im US-Gesundheitswesen wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte ihr Verhalten sowie auch ihre Denkweise ändern. Schwarze sollten nicht mehr als leidensfähiger angesehen werden, ihre Beschwerden sind ernst zu nehmen und es ist Aufgabe der Ärzte eine Vertrauensbasis in der afroamerikanischen Bevölkerung zu schaffen, da das Vertrauen seit der Tuskegee-Syphilis-Studie verloren gegangen ist, wie die Corona-Pandemie bestätigte. Die afroamerikanische Bevölkerung meidet Arztbesuche.
Methoden und Maßnahmen zum Vertrauensaufbau wurden zu Pandemie-Zeiten von Einzelpersonen zwar bereits visiert, wie beim „HAIR-PROJECT“, welches zusätzliche Standorte für den Zugang zu Informationen und für die Gesundheitserziehung schaffen sollte, jedoch sind solche Maßnahmen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch die Seltenheit. Hier ist noch eine Menge mehr zu tun, um dem Rassismus entgegenzusteuern.